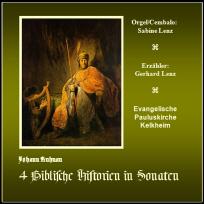Kuhnau - Biblische Historien
Johann Kuhnau - Kirchenmusiker und Jurist
* 6.4.1660 in Geising (Erzgebirge) - † 5.6.1722 in Leipzig.
Kuhnaus Familie stammte ursprünglich aus Böhmen. Wegen ihrer Zugehörigkeit zum evangelischen Glauben wurde sie aber im Zuge der Gegenreformation aus dem Habsburgerreich vertrieben. Der Familienname lautete ursprünglich auf Kuhn; erst Johann und seine Brüder nannten sich Kuhnau.
Der Vater Barthel, ein Tischler, heiratete am 18.2.1656 die Schneiderstochter Susanna Schmied. Aus der Ehe gingen zahlreiche Kinder hervor; drei Söhne wurden Musiker. Außer Johann, dem bedeutendsten, waren dies Andreas (1657-1721) und Gottfried (1674-1736).
Um das Jahr 1670 kam Johann Kuhnau als Schüler an die Kreuzkirche in Dresden. Seine musikalische Ausbildung erhielt er bei den Schützschülern Alexander Heringk und Vincenzo Albrici. Als im Jahre 1680 eine Pestepidemie in Dresden ausbrach, kehrte er kurzfristig zu seinen Eltern nach Geising zurück.
Bald danach ging er nach Zittau, wo er zum Begräbnis des dortigen Kantors Erhard Titius am 19.5.1681 eine fünfstimmige Motette „Ach Gott wie læstu mich erstarren” komponierte, - es ist die früheste nachweisbare Komposition Kuhnaus. In Zittau wirkte er danach als praefectus chori und als Organist an St. Johannis. Er stand in einer freundschaftlichen Beziehung zum Rektor Christian Weise, bei dessen Aufführungen von Schuldramen er mehrfach mitwirkte. Im Jahre 1682 verließ Kuhnau Zittau, wobei die Tatsache mitbestimmend gewesen sein dürfte, daß Johann Krieger als Organist an St. Johannis eingestellt wurde. Er wandte sich daher nach Leipzig, wo er sich als Organist an die Thomaskirche bewarb. Ihm wurde jedoch Gottfried Kühnel vorgezogen, der aber bereits 1684 starb. Eine zweite Bewerbung Kuhnaus hatte Erfolg.
Seit 1682 und auch noch während seines Wirkens als Organist betrieb Kuhnau juristische Studien, die er 1688 mit der Dissertation „De Juribus circa musicos” erfolgreich abschloß. Von dieser Zeit an bis ins Jahr 1701 war er auch als Anwalt tätig.
Am 12.2.1689 heiratete er Sabine Elisabeth Plattner aus Leipzig, mit der er sechs Töchter und zwei Söhne hatte.
Im Jahre 1701 wurde er Thomaskantor in der Nachfolge von Johann Schelle, der im gleichen Ort wie Kuhnau geboren und nur um wenige Jahre älter als dieser war. Als Thomaskantor hat Kuhnau viel komponiert. Da der größte Teil der Kompositionen für den Tagesgebrauch bestimmt war und daher nicht gedruckt wurde, hat sich von den überwiegend kirchenmusikalischen Werken allerdings wenig erhalten. Dagegen hat Kuhnau den Brauch eingeführt, die Libretti der aufgeführten Werke im voraus drucken zu lassen. Die Tätigkeit als Thomaskantor wurde für Kuhnau zunehmend unbefriedigend. Gründe hierfür sind einerseits in den Auswahlkriterien zu suchen, nach denen die Schüler aufgenommen wurden - wegen der schlechten Vorbildung konnten nur wenige Schüler für die sonntäglichen Gottesdienste herangezogen werden - andererseits entstand in den Musikern Telemann und Fasch zeitweise eine starke musikalische Konkurrenz in Leipzig. Darüber hinaus mußte er erleben, daß immer wieder in wenig schöner Weise in seine Rechte eingegriffen wurde. Zwar konnte er letztlich diese Angriffe abwehren, aber sie brachten ihm häufig Ärger ein. Die letzten Lebensjahre Kuhnaus waren zusätzlich durch Krankheit gezeichnet. Er starb schließlich an der Lungenschwindsucht.
Eine umfassende Bildung ermöglichte es Kuhnau, in vielen Bereichen anregend zu wirken. Seine Zeitgenossen haben ihn hoch gelobt. Sie rechneten ihn, neben Keiser, Telemann und Händel, zu den vier größten deutschen Komponisten der damaligen Zeit. Leider ist von dem Schaffen Kuhnaus wenig erhalten, so daß wir dieses Urteil heute nicht mehr recht nachvollziehen können.
Die erste Periode, bis etwa zum Jahre 1700, widmete Kuhnau vor allem Kompositionen für das Klavier. Seine Werke dienten insbesondere der Förderung der technischen Entwicklung dieses Instruments. Kuhnaus Kompositionen waren so populär, daß er von diesen damals beinahe seinen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Im zweiten Teil der Klavierübung aus dem Jahre 1692 verwendete er das erste Mal den Titel „Sonate” für ein Klavierstück. Der Erfolg seiner Klavierkompositionen beruhte vor allem darauf, daß er sich im Gegensatz zu den meisten Komponisten seiner Zeit nicht an ein höfisches, sondern an ein bürgerliches Publikum wandte. Es sprach für das Geschick Kuhnaus, durch ein dichtes Gewebe musikalischer Formen sowohl den gebildeten Musiker als auch durch verständliche Inhalte den Musikliebhaber anzusprechen. Den Höhepunkt dieser Schaffensperiode bilden zweifellos die „Biblischen Historien”, - Klavierstücke.
Gleichzeitig versuchte sich Kuhnau als Romanschriftsteller, der mit zum Teil beißendem Spott die musikalischen Zustände seiner Zeit karikierte.
Im zweiten Lebensabschnitt entstanden fast ausschließlich kirchenmusikalische Werke, von denen leider auch nur wenige überliefert sind. Sie wurden, im Gegensatz zu seinen Klavierwerken, von seinen Zeitgenossen als bereits veraltet bezeichnet. Diese Behauptung läßt sich zwar wegen der dürftigen Quellenlage kaum nachprüfen, aber allein die Tatsache, daß er wegen der oben genannten Schwierigkeiten im Amt resigniert hatte, läßt vermuten, daß er wenig Energie in seine Kirchenmusik investierte.
Am Ende bleibt noch erwähnenswert, daß Kuhnau der unmittelbare Vorgänger Johann Sebastian Bachs im Amt des Thomaskantors gewesen ist.
Die Biblischen Historien
1700 wurde ein Sammelwerk von Sonaten veröffentlicht unter dem Titel
Musicalische Vorstellung
einiger Biblischer Historien in 6 Sonaten /
Auf dem Claviere zu spielen /
Allen Liebhabern zum Vergnügen /
versuchet von Johann Kuhnauen /
Leipzig / 1700
Um welche Bibelgeschichten es sich handelt, zeigen die Überschriften der sechs Sonaten:
1. Der Streit zwischen David und Goliath
2. Der von David vermittelst der Music curirte Saul
3. Jacobs Heyrath
4. Der todtkrancke und wieder gesunde Hiskias
5. Der Heyland Israelis/Gideon
6. Jacobs Tod und Begræbniß
Diese Sonatensammlung nach bekannten Geschichten des Alten Testamentes hat von den Werken Kuhnaus die weiteste Verbreitung gefunden. Es handelt sich um Klangstücke, deren Satzcharakter, -zahl und -folge nicht von der Form, sondern von dem Gerüst des Handlungsverlaufs bestimmt sind. Homophone und streng polyphone Sätze, figurierte Choräle, Liedformen und tanzartige Stücke stehen den programmatischen Forderungen entsprechend in bunter Folge nebeneinander. Auf einmalige Weise wird im Sinne der Affektenlehre und der Rhetorik mit thematischer Arbeit, motivischen Entsprechungen und symbolischen Deutungen ein herausragendes Werk geschaffen – Kuhnau legt geradezu Musterbeispiele für die Nachbildung außermusikalischen Geschehens mit den Mitteln der Tonmalerei vor.
Kuhnau hat die damals allgemein bekannten Geschichten vor jeder Sonate noch einmal nacherzählt, und zwar nicht mit den Worten der Bibel, sondern auf seine eigene höchst belustigende und umständlich ausgeschmückte Art und Weise. In der Folge läßt der als Spötter bekannte Meister mit entwaffnender Naivität - um nur auf eine Tonmalerei hinzuweisen - im Satz 2 der Sonate „Der Streit zwischen David und Goliath” die Israeliten zugleich zittern und beten: zittern durch eine zu Beginn chromatisch abwärts geführte Baßstimme, die das Sinken des Mutes der Israeliten deutlich macht, und die in schwebenden, vibratomäßig zu spielenden Baßakkorden weitergeführt wird, beten mit der in Takt 5 einsetzenden cantus-firmus-Melodie des Chorals „Aus tiefer Not schrei ich zu dir”, die dann mit kühnen Zwischendissonanzen durchgeführt wird.
Leider ist nicht bekannt, wie das Programmatische der Sonaten von den Zeitgenossen aufgefaßt und verstanden wurde. Man darf jedoch annehmen, daß der starke Anklang, den die „Biblischen Historien” damals gefunden haben, nicht allein auf die neuartige Form und auf das Programmhafte zurückzuführen ist, sondern ebenso auf die eigentümlichen Nacherzählungen Kuhnaus.
Letzte Änderung am 12. Dez. 2020