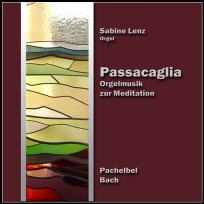Passacaglia
Ein kurzer Abriss der Geschichte der Passacallia
Der Begriff „Passacaglia“ leitet sich von dem spanischen Begriff „passacalle“ ab. Er bedeutet übersetzt „durch eine Straße gehen“. Etwas freier übersetzt entspräche dies dem deutschen Ausdruck „Gassenhauer“. Zu den Zeiten ihrer Entstehung im Spanien des 16. Jahrhunderts handelte es sich zumeist um Gitarrenmusik oder ein instrumentales Zwischenspiel bei Liedern und Tänzen. Im Laufe der geschichtlichen Entwicklung wandelte sich der Begriff - zu dem heute in Deutschland gebräuchlichen „Passacaglia“ - und seine Bedeutung. Es handelte sich jedoch immer um eine variierende Reihung gleichartiger Abschnitte.
Bei der Beschreibung der Passacaglia darf auch die ähnliche Chaconne (Ciacona) nicht unberücksichtigt bleiben, da sich beide Formen parallel entwickelten und aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten nicht immer klar zu unterscheiden sind.
Heute versteht man unter einer Passacaglia eine Instrumentalmusikform mit ständiger Wiederholung einer melodischen Floskel zum Beispiel als Basso ostinato. Diese Tonfolge im Bass ist im allgemeinen weniger eine eigenständige Melodie, sondern sie lässt sich aus der Kadenz ableiten. Jedoch tritt in den großen Passacaglien des 18. und 20. Jahrhunderts dieses Ostinato als geschlossenes, motivisch differenziertes Thema auf. Es enthält in vielen Fällen einen absteigenden Tetrachord; dabei endet jede Sektion auf dem Halbschluss und schließt erst ganz am Ende des Stückes mit der Tonika ab. Die Passacaglia beginnt oft auftaktig und steht in einer Molltonart. Ihr meist langsames Zeitmaß verleiht ihr einen gravitätisch-emphatischen Charakter.
Dagegen steht der Begriff „Chaconne“ für eine Variationsfolge, deren Basso ostinato nicht so streng geführt werden muss wie der einer Passacaglia. Die Chaconne beginnt in der Regel abtaktig, hat einen heiteren Charakter und verwendet meist Durtonarten.
Wie schon erwähnt, hat die Passacaglia ihren Ursprung im Spanien des 16. Jahrhunderts, während die Chaconne wahrscheinlich amerikanischer Herkunft ist. Sie wurde dort von Bediensteten getanzt und gesungen, kam dann aber nach Spanien und lag so in ihrer Entwicklung und Verbreitung über Europa gegenüber der Passacaglia anfangs um einige Jahre zurück.
Noch im 16. Jahrhundert wurde der spanische „passacalle“ als „passacallo“ auch in Italien heimisch. Die aus Spanien kommende Gitarren-Passacaglia wurde dort in Verbindung mit Ostinato-Variationen vorgetragen, welche schon als Tanzbass-Variationen seit dem 13./14. Jahrhundert als Variationsmodell dienten und sehr populär waren. Aber auch in der alten Form der Passacaglia war die Variation über ostinaten Bässen bekannt.
Die weitere Entwicklung der Passacaglia im 17. Jahrhundert vollzog sich hauptsächlich in Italien und Frankreich. In Spanien entwickelte sich wie in Italien die Variations-Passacaglia und blieb seit 1640 als Tanz erhalten. Sie wies dort weder ein strenges Basso ostinato auf, noch war sie auf einen Dreiertakt fixiert, sondern war in der Form frei und behielt in den Variationen nur ihr harmonisches Gerüst und die Metrik bei.
In Frankreich ist die Passacaglia unter dem Namen „passacaille“ seit 1614 nachzuweisen. Hier war sie zuerst ein kurzer variationsloser Tanzsatz. Schon diese Frühform hatte ein konstantes harmonisches Gerüst und bevorzugte den Dreiertakt in ruhigem Zeitmaß. Louis Couperin (1626-1661) verband in Frankreich die „Instrumental-Passacaglia“ mit dem Rondeau, wobei die Couplets und der Refrain oft denselben oder einen ähnlichen Bass hatten. Dadurch kam es zur Annäherung an die „Variations-Passacaglia“. Neben dieser Passacaglia als Formteil von Arien und Tänzen gab es sie bald auch als selbständige Ostinatoreihe. Im Gegensatz zur Chaconne wies die Passacaglia in Frankreich eine höhere Basskonstanz und ein ruhiges Tempo auf und verwendete ein harmonisches Gerüst, welches auf einer Kadenz aufgebaut war.
Ein besonderes Merkmal der französischen Passacaglia ist neben dem Rondoprinzip jedoch die paarweise periodische Gliederung der Sätze; das bedeutete, dass je zwei Sätze zu einer übergeordneten Sektion zusammengefasst wurden. Die Chaconne wurde hier ebenso wie in Italien von Komponisten weitaus häufiger benutzt, wobei die Begriffe Passacaglia und Chaconne schon seitens der Komponisten nicht immer klar verwendet wurden und teilweise austauschbar sind.
In Frankreich wurde die Chaconne trotz ihrer Herkunft wie auch zuvor die Passacaglia Bestandteil des „Ballet de cour“ und nach dem Vorbild der frühen spanischen Chaconne, jedoch in größeren Dimensionen, verwendet. Hier stand das Ostinato etwas zurück, und es wurden meist akkordische Gerüste variiert. Schon vor der Passacaglia bestand hier die Verbindung zwischen Chaconne und Rondeau.
In Deutschland wurden sowohl die italienische Form der Passacaglia, in der nur das Harmoniegerüst wiederholt wurde, als auch die französische in Italien mit der Chaconne verbundene Ostinato-Form, die häufig in Verbindung mit dem Rondeau stand, seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts angewandt. Dabei überwog in Deutschland die Passacaglia mit Basso ostinato, also die französische Form. Sie unterschied sich durch ihren ruhigen Charakter und die Molltonalität von der Chaconne. Aber es kam besonders hier zu einem Verwischen der beiden Stile. In beiden wurde oft der fallende Tetrachord genutzt. Das vorwiegend strenge Ostinato in den Werken von Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704), Dietrich Buxtehude (1637-1707) und Johann Sebastian Bach (1685-1750) weist aber nach Frankreich.
Mit Ende der Generalbasszeit verschwand auch der Begriff „Passacaglia“ weitgehend aus der Musik. Jedoch wurden auch nach 1750 passacagliaähnliche Stücke komponiert, welche jedoch nicht diese Bezeichnung erhielten. Andererseits wiesen so benannte Stücke kaum noch Ähnlichkeiten mit den Formen von Chaconne und Passacaglia auf.
Eine Renaissance erlebten die alten Formen im auslaufenden 19. Jahrhundert zuerst in der Orgel- und Klaviermusik von Max Reger (1873-1916) und später bei Paul Hindemith (1895-1963).
Wie die meisten ihrer Zeitgenossen orientierten sie sich an der Passacaglia von Bach mit ihrem ostinaten Bass. Dadurch kam es zu der nicht korrekten Auffassung, der Basso ostinato müsse am Anfang einer Passacaglia oder Chaconne allein erklingen. Dies war zu Bachs Zeiten aber eine Ausnahme.
Bei der atonalen Musik übernahmen Kunstformen wie die Passacaglia die formgebende Funktion, da Harmonik und Melodik ihren formgebenden Charakter verlieren. Dies erklärt auch die häufige Verwendung der Passacaglia und anderen Ostinato-Formen im 20. Jahrhundert.
Bachs Passacaglia c-moll
Die Entstehungszeit von Bachs Passacaglia ist bis heute nicht genau festgestellt, da nur Kopien, die zwar den Zeitraum nach hinten abgrenzen, aber kein Autograph Bachs, der den eigentlichen Zeitpunkt der Entstehung bezeugen würde, erhalten sind. So besteht nicht nur Uneinigkeit darüber, in welchem genauen Jahr Bach die Passacaglia geschrieben hat, sondern es gibt sogar sehr unterschiedliche Meinungen in der Frage, welcher Schaffensperiode Bachs dieses Werk zuzuordnen ist. Dabei begründen die Vertreter der Meinung, die Passacaglia sei später entstanden, dieses mit Bachs großer technischer Meisterschaft in dem Werk. Diejenigen, die glauben, es sei schon früher entstanden, begründen dies unter anderem damit, dass Johann Sebastian Bach nach seiner Weimarer Zeit bis 1717 als Organist am Hofe von Herzog Wilhelm Ernst nie wieder einen Organistenposten bekleidet habe.
Die Passacaglia c-moll BWV 582 besteht aus einem Passacaglia- (Takt 1-168) und einem Fugenteil (Takt 169-292). Beide beginnen auftaktig. Sie gehen fließend ineinander über, was ein Kennzeichen der Norddeutschen Orgelschule ist. Dies ist nicht verwunderlich, da Bach nach seinen Aufenthalten in Hamburg bei Reinken und in Lübeck bei Buxtehude ein begeisterter Anhänger dieses Stils war.
Für seine Passacaglia und Fuge verwendet Bach ein Maß von vier Takten über ein Thema des französischen Organisten André Raison (vor1650–1719), an welches er ein zweites Maß von vier Takten anhängt, um als Basis eine komplette zweiphrasige Periode zu erhalten. Dies ist unüblich gegenüber früheren Formen der Passagcaglia die nur aus vier Takten aufgebaut sind, sich bewegend von Tonisch zu Dominant. Bach schrieb über der Grundfigur 20 Variationen (wahrscheinlich ausgewählt unter vielen improvisierten Variationen), um die Passacaglia so auszuprägen, wie wir sie heute kennen.
Zu Beginn der Passacaglia wird das Thema im Bass vorgestellt. Dies ist eine ungewöhnliche Vorgehensweise und nicht ein typisches Merkmal der Passacaglia im allgemeinen, wie man aufgrund dieses Werkes meinen könnte. Zu Bachs Zeiten war es nicht üblich, das Basso ostinato alleine vor das Werk zu stellen, da es meist nur aus einer erweiterten Kadenz bestand und kaum melodische Züge trug. Im Gegensatz dazu liegt hier als Basso ostinato ein vollständiges Thema vor, welches diesem Terminus auch gerecht wird. Es besteht aus zwei Teilen, einem melodischen und einem kadenzierenden, die aber eine Einheit bilden. Aus diesem Themenmaterial schöpft Bach auch in einigen Variationen, in denen Thementeile - teils in veränderter Form - wieder auftauchen. Alle Töne der harmonischen c-moll-Tonleiter im Thema (in verschiedenen Oktaven) sind enthalten, und einige Motive sich allein schon deswegen darauf zurückführen lassen.
Bach schrieb als Ergänzung und Komplettierung anschließen eine Fuge über das Originalthema Raisons. Dass die Passacaglia und Fuge zusammengehören und miteinander verbunden sind - die Anfangsnote der Fuge ist enthalten im Schlussakkord der zwanzigsten Variation - gehört zur Besonderheit dieses Orgelwerkes. Dabei ist dem Orgelspieler freigestellt, ob er die erste Note der Fuge, das c′ im Alt, neu anschlägt oder im Schlußakkord des Passacagliateils liegenläßt.
Bei der Fuge handelt es sich um eine Permutationsfuge. Deren Thema (A) ist die erste Hälfte des Passacagliathemas, also das originale ′Raison-Thema′. Es tritt stets in realer Form, also mit unveränderten Intervallen, auf. Das erste Kontrasubjekt (B), welches den Charakter eines zweiten Themas hat, lässt sich aus dem zweiten Teil des Passacagliathemas herleiten; die charakteristischen Halbtonschritte (d-es, H-c) sind in den Achteln wiederzufinden. Das zweite Kontrasubjekt (C) taucht ab Takt 174, dem zweiten Themeneinsatz, auf und wird im Laufe der Fuge nicht ganz so streng behandelt.
In ihrem für Bachs Fugen typischen Manualitermittelteil erscheint das Thema zweimal in Durgestalt. Die dort vorherrschende Tonart, Es-Dur, ist Durparallele zu c-moll Zu Beginn des ′Thema fugatum′ ist die Zahl der Vorzeichen von drei auf zwei B′s reduziert. Trotzdem ist c-moll und nicht g-moll weiterhin die Grundtonart der Fuge.
Zu den anderen Stücken der Aufnahme
Innerhalb der Ciaconen Pachelbels ist deutlich das Wachsen seiner Technik zu spüren. Die Ciacona in d lässt über einem sechzehnmal unverändert wiederkehrenden Bass die Oberstimmen in progressiver Entwicklung figurieren. Dabei werden nicht toccatenhafte Virtuosenpassagen, sondern melodische Fortspinnungsglieder verwendet. Eine Spezialität ist das wiederholte Zitieren der Ausgangsform inmitten der Variationskette.
Die Ciacona in f ist unbestritten das Meisterwerk unter seinen Ciaconen. Sie basiert auf 22 Doppelvariationen und brilliert durch das vielfältige Material das aus einer einzigen Idee abgeleitet werden kann.
Das Präludium in d von Pachelbel beginnt mit dem Thema, das die beiden Manualstimmen imitatorisch aufgreifen. Nach dieser Themenvorstellung erfolgt fast wörtlich eine Wiederholung auf der Dominante A, die dann in Arpeggien ausläuft. Ein ruhiger Mittelteil steht vor einem seltsamen, nur-akkordischen Satz, dem sich der Ausklang in ruhiger Bewegung, entfernt an den Beginn angelehnt, anschließt.
Praeludium und Fuge in h-moll von Bach, pro organo pleno, besitzt im Thema ein ungewöhnlich reiches Arabeskenwerk, das sich girlandengleich reiht. In der Melodik nimmt dieses innige ergreifende Stück den Charakter einer mit sanfter Wehmut erfüllten Arie an. Die Tonart h-moll und diverse musikalische Symbole weisen es als Passionsmusik aus. Exakt im golden Schnitt erscheint im Praeludium eine entscheidende Wendung nach D-dur („Auferstehungstonart“), in der Fuge erscheint ein neues, fanfarenartiges Thema.
Das Präludium in c von Bach kann man den Meisterwerken aus der Leipziger Zeit zur Seite stellen. Der B-Teil enthält ein Fugato mit beibehaltenem Kontrapunkt, der Triolensätze aus dem A-Teil fortspinnt. Die Fuge ist einfach gearbeitet – was wohlgemerkt nur etwas über die kontrapunktische Setzweise aussagt und nicht im Bezug auf die musikalische Schönheit zu werten ist. Außer einem Einsatz auf es und f begegnen nur Tonika- und Dominanteinsätze.
Letzte Änderung am 06. Jan. 2025