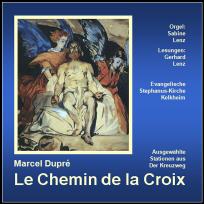Jesu, meine Freude
Ich steh hier und singe
Trotz dem alten Drachen, / Trotz dem Todesrachen, / Trotz der Furcht dazu! / Tobe, Welt, und springe; / ich steh hier und singe / in gar sichrer Ruh.
Wer kann dies allen Ernstes von sich behaupten? Klingt dieser Text nicht unglaubhaft bei all den Nachrichten, die uns tagtäglich über die Medien erreichen?
Kann man musizieren im Wissen um die derzeitigen Auseinandersetzungen in Afghanistan oder in Israel und Palästina?
Kann oder darf man eigentlich noch froh musizieren? Konnte man das überhaupt damals nach Auschwitz oder sogar in Auschwitz? Nach Hiroshima, den Vertreibungen während und nach der Kriege, die weltweit im letzten Jahrhundert stattfanden? Oder, um es weniger bequem zu machen: Wir selbst fügen anderen Leid zu oder müssen Leid, verursacht durch andere oder durch anonyme Schicksalsschläge, aushalten, ohne ausweichen oder unsere Lage ändern zu können.
Kann oder darf man musizieren im Bewusstsein all dieses Elendes?
Die Antwort sollte „Ja“ lauten. - Wer sich auch im tiefsten Leid und unter Qualen von Gottes Gegenwart gehalten weiß, der kann noch aus der Tiefe zu Gott rufen und ihn loben.
So ist die Musik, das Musizieren wie das Singen und auch das Hören, ein Loben Gottes, bei dem wir unsere engen Lebensgrenzen überschreiten. Es geht uns zugleich eine Ahnung von Gottes Macht und Gottes Wahrheit auf, die uns ganz mit der Gegenwart des lebendigen Gottes auch in unserem Leben erfüllen kann.
Johann Franck schrieb 1653 das Lied „Jesu, meine Freude“. Der Ratsherr und Bürgermeister in der Niederlausitz kannte die Schrecken des zurückliegenden 30-jährigen Krieges. Und trotzdem vermochte er zu dichten:
Tobe, Welt und springe; / ich steh hier und singe / in gar sichrer Ruh. / Gottes Macht hält mich in acht, / Erd und Abgrund muß verstummen, / ob sie noch so brummen!
Sein Zeitgenosse Johann Crüger komponierte die uns heute noch bekannte Melodie dazu.
Musik, im tiefsten Sinne selbst ein Wunder Gottes, kann uns helfen den Wundern Gottes nahe zu kommen: Wort und Musik zugleich erreichen im Singen unsere Seele und schließen sie so auf für Gottes Gegenwart und Gottes Wirken.
Darum ist das Loben Gottes, auch in dunkler Zeit, ein untrügliches Zeichen von Gottes Gegenwart und Hilfe, die uns die Kraft gibt, unser Leben, wie es auch sei, anzunehmen als Gottes Gabe an uns. Damit werden auch wir zum Zeichen der Gegenwart Gottes in dieser Welt. Und in der Freiheit des von Gott getragenen und gehaltenen Glaubens loben wir Gott und danken ihm für die Wunder, die er auch in unserem Leben tut.
Die Komponisten
Joseph Johannes Clemens Ahrens wurde am 17. April 1904 in Sommersell, Westfalen, geboren. Er erhielt seine Ausbildung in Münster von Fritz Volbach und an der Akademie für Kirchen- und Schulmusik in Berlin von Alfred Sittard und Max Seiffert. Anschließend wirkte er ab 1928 als Dozent und von 1936 bis 1969 als Professor für Kirchenmusik an der staatlichen Hochschule für Musik in Berlin. Im Jahr 1934 wurde er Domorganist an der St. Hedwigskirche und 1945 bis 1957 and der Salvatorkirche. Ahrens starb 1997.
Berühmt wurde er vor allem durch den virtuosen Stil seiner Orgelkompositionen. Er schrieb für die Orgel zahlreiche Konzerte, Toccaten, Praeludien, Fugen und Partiten. Ahrens ist zu den ersten Kirchenmusikern des 20. Jahrhunderts zu zählen.
Johann Gottlob Töpfer wurde am 4. Dezember 1791 in Niederroßla, Thüringen geboren. Er wurde von Franz Seraph von Destouches und August Eberhard Müller zum Organisten ausgebildet. Er wirkte ab 1817 als Seminarmusiklehrer und ab 1830 als Stadtorganist in Weimar, wo er am 6. Juni 1870 starb.
Durch seine Publikationen über Orgelspiel und besonders über Orgelbaukunst hat sich Johann Gottlob Töpfer in der Geschichte der Orgel einen Namen gemacht. Er hat durch theoretische Abhandlungen und Kompositionen der Orgel den Weg zur Romantik gewiesen.
Johann Gottfried Walther wurde am 18. September 1684 in Erfurt geboren. Walther war Cousin zweiten Grades von Johann Sebastian Bach. Er wurde 1702 Thomasorganist in Erfurt, wirkte ab 1707 als Stadtorganist und Musiklehrer der herzoglichen Prinzen und ab 1721 als Hofmusiker in Weimar, wo er am 23. März 1748 starb.
Der Organist, Musikschriftsteller und Komponist verfasste eine Anzahl Choralvorspiele und Choralbearbeitungen für Orgel von bedeutender Qualität und eine Reihe ebenso vorzüglicher Orchesterwerke. Daneben war er auch schriftstellerisch tätig. Seine Schulwerke, vor allem jedoch das „Musicalische Lexicon“, bieten einen wertvollen Überblick über die Musik und Musiktradition zur damaligen Zeit.
Letzte Änderung am 06. Jan. 2025